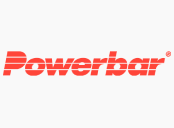Die weibliche Physiologie und der Menstruationszyklus im Fokus der Sportwissenschaft und -praxis: Ein Trend oder wissenschaftlich haltbar? Durch die gewachsene mediale Präsenz und das thematische Aufspringen großer Sportmarken hat sich das Thema rund um den weiblichen Zyklus in den letzten fünf Jahren rasant verbreitet. In einem Modul des Landestrainer-Hauptseminars haben Sabrina und Florian Dieskau darüber referiert. Mit ihrer Firma Kraftbasis beschäftigen sich die Sportwissenschaftlerin und Ernährungsberaterin sowie der Physiotherapeut mit diesem Thema.
Während es die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen rund um die Frage: “Können sich die hormonellen Schwankungen des Menstruationszyklus auf die sportliche Leistung auswirken?” bereits in den 1970er Jahren gab, sind gerade in den letzten fünf Jahren immer mehr Studien veröffentlicht worden. Das, teilweise ernüchternde, Ergebnis: Es gibt Studien, die Unterschiede in den verschiedenen Zyklusphasen feststellen, aber der Großteil konnte keine Veränderungen in der sportlichen Leistung beobachten. Das hat zur Folge, dass aktuell davon abgesehen wird, generalisierte und sportartübergreifende Empfehlungen auszusprechen – auch Trainingspläne, die bestimmte Trainingsinterventionen pro Zyklusphase vorsehen, lassen sich wissenschaftlich nicht halten. Warum der Menstruationszyklus, die weibliche Physiologie und das Bewusstsein seitens der Trainer dafür wichtig ist, wird im Folgenden betrachtet.
Was ist der Menstruationszyklus?
Bei der Beschreibung des Zyklus wird in der Regel auf den 28-tägigen Zyklus zurückgegriffen, da sich die Phasen und Ereignisse besser veranschaulichen lassen. In der Praxis finden sich Zyklen zwischen 25 und 35 Tagen, nur 10 bis 15% der Frauen haben einen exakt 28-tägigen Zyklus.
Zu Beginn des Zyklus steht die Menstruation, auch als Periodenblutung bekannt. Setzt die Blutung ein, so beginnt mit Zyklustag 1 ein neuer Zyklus. Die Periode dauert je nach Frau drei bis sieben Tage. Mit dem Einsetzen der Blutung beginnt auch die Follikelphase, welche im Beispielzyklus den Zeitraum von Tag 1 bis 14 beschreibt. Die anschließende Phase ist die Lutealphase, sie beschreibt Tag 15 bis 28. Zwischen den beiden Phasen kommt es zum Eisprung, ein Ereignis von wenigen Stunden.
Transfer und Relevanz in der Praxis
Betrachtet man nun die einzelnen Phasen und die damit verbundenen, möglichen Auswirkungen auf die sportliche Performance, so bemerkt man schnell, dass es sich um eine hochindividuelle Sache handelt. Zu Beginn des Zyklus, in der Menstruationsphase, gibt es zum einen Frauen, welche sich gut fühlen und wenig Symptome empfinden. Andererseits kann es zu sehr starken Symptomen in Form von bspw. Unterleibsschmerzen kommen und es ist in dieser Zeit nicht im Entferntesten an Sport zu denken. Für die Trainingsgestaltung bedeutet das, in die Kommunikation zu gehen und das Training gegebenenfalls anzupassen. Rein hormonell betrachtet spricht in der Menstruationsphase nichts gegen Sport oder gar das Absolvieren eines Wettkampfs. „In Spanien gibt es eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen für Regelschmerzen“, erläutert Beachvolleyballerin Karla Borger, „in Deutschland sind wir davon noch weit weg“. Die Zahl der Frauen mit Problemen sei „viel höher als wir denken“, so die Präsidentin von Athleten Deutschland.
Befragt man Sportlerinnen, wann sie am liebsten ihren Wettkampf bestreiten wollen, so kommt eine Antwort häufig vor. In einer Umfrage australischer (Para-)Athletinnen war die einstimmige Antwort “right after my period” – also nach dem Ende der Periode und somit etwa in der zweiten Hälfte der Follikelphase. In dieser Zeit fühlen sich die meisten Sportlerinnen am leistungsfähigsten. Genauso sieht es in der Eisprungphase aus. In der anschließenden Lutealphase kann es zu einer langsameren Regeneration und Motivationsproblemen kommen. Diese Phase zeichnet sich durch höhere Hormonlevel aus, im Vergleich zur Follikelphase, welche jede Frau wiederum unterschiedlich erlebt. In der Lutealphase kann es im Training Sinn machen, den ein oder anderen Regenerationstag mehr einzulegen – sofern die Athletin davon profitiert. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sagte in einem ZDF-Interview: „In meinem Training spielt der Zyklus eine große Rolle, gerade auch an Tagen, an denen ich mich zyklusbedingt nicht ganz so stark fühle oder nicht so belastbar bin.“
Die weibliche Anatomie und Sportverletzungen
Dass der weibliche Körper anders aufgebaut ist als der männliche und, rein evolutionsbiologisch betrachtet, anderen Aufgaben folgen soll, ist bekannt. Im Wachstum und in der Pubertät verändert sich der weibliche Körper. Beispielsweise wird das Becken breiter. Dadurch verändert sich der sogenannte Q-Winkel, was zur Folge haben kann, dass das Knie anders unter der Hüfte läuft. Die Beinachse verändert sich und Fähigkeiten wie Sprinten, Springen und Landen müssen ggf. neu erlernt werden.
Eine instabile Beinachse kann Verletzungen fördern. Sportlerinnen erleiden aufgrund dieser Unterschiede fünf- bis siebenmal häufiger einen Riss des vorderen Kreuzbandes als Sportler – und das ohne Fremdeinwirkung oder Gegnerkontakt.
Trainer, die Wissen über diese Veränderungen verfügen, können im Training andere / neue Schwerpunkte setzen und ihre Athletinnen bei der Verletzungsprävention unterstützen.
Energiemangel im Sport – Der Zyklus als Feedbacksystem
Während über den Verlauf des Artikels deutlich geworden ist, dass es sich um eine sehr individuelle Herangehensweise handelt und wir derzeit keine generalisierten Trainingsempfehlungen aussprechen können, so gibt es eine Funktion des Zyklus, die im Training dringend berücksichtigt werden solle: Er ist ein sensibles Feedbacksystem. Kommt es zu einem Energiemangel im Sport, hervorgerufen durch zu viel Training und zu wenig Energie durch Nahrung und unzureichende Regeneration, kann es zu unregelmäßigen Zyklen kommen. Bleibt die Periode über mehrere Zyklen aus, so ist dies als Alarmsignal zu sehen, welches sich langfristig auf die Gesundheit der Athletin auswirken kann. Eine ausbleibende Periode kann zu einem gestörten Hormonsystem führen, was bspw. in verminderter Knochendichte und einem erhöhten Ermüdungsbruchrisiko enden kann.